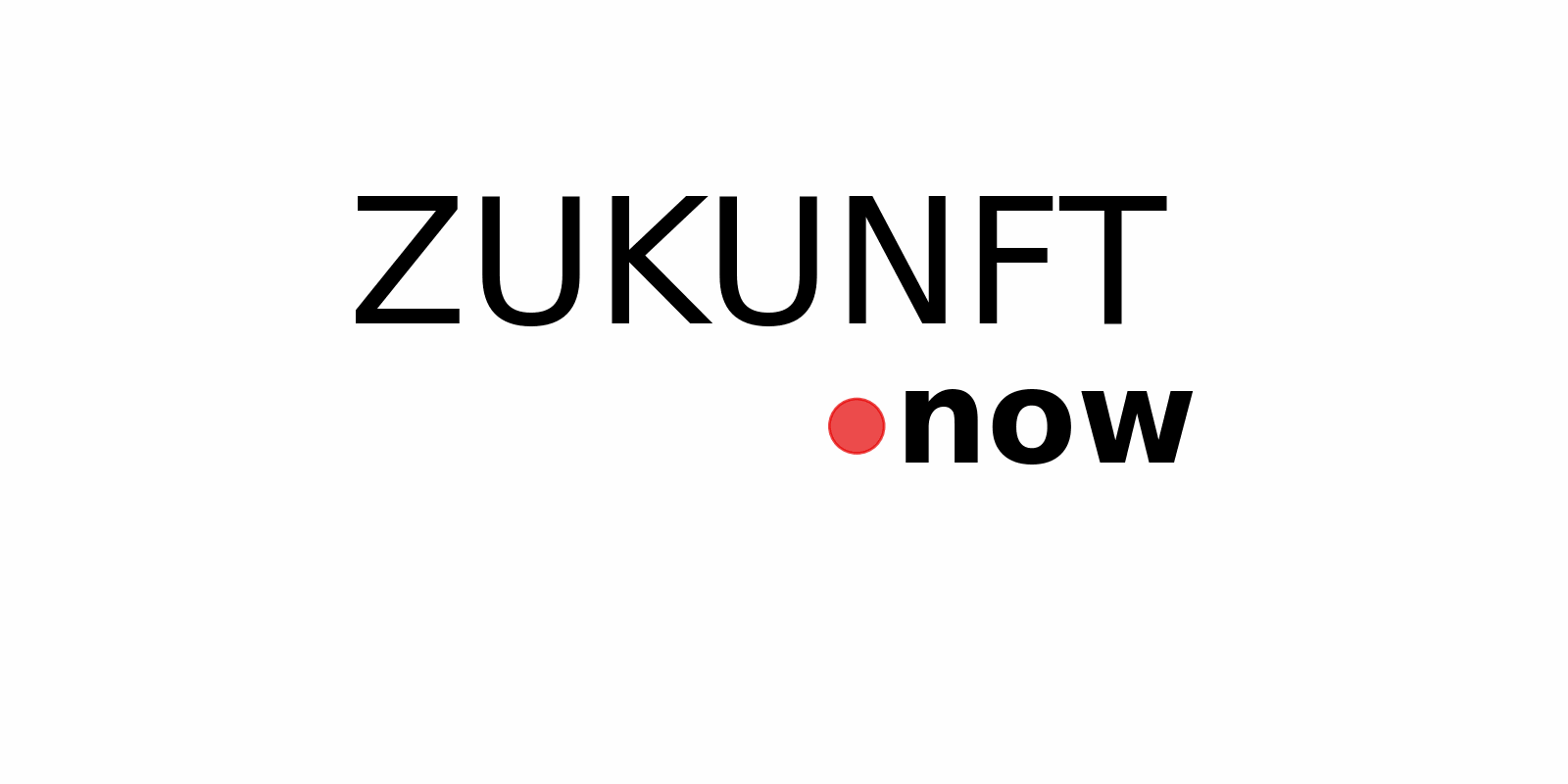- Lars M. Heitmüller
- 30. Mai

Veröffentlicht am 29. Mai 2025 | von Lars M. Heitmüller
Die re:publica 2025 war wieder ein Leuchtturm digitaler Debatten – und einer der eindrücklichsten Momente war die Eröffnungs-Keynote von Prof. Dr. Björn Ommer, Informatiker und Mitentwickler des KI-Modells Stable Diffusion. In seiner Rede „Generative KI und die Zukunft der Intelligenz“ beleuchtet Ommer nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch deren Einfluss auf unsere Denkweise, unsere Gesellschaft und die globale Machtordnung.
🧠 Von System 1 zu System 2 – Wie KI unser Denken verändert
Ommer beginnt mit einer fundamentalen psychologischen Perspektive: Er greift die Theorie der zwei Denksysteme von Daniel Kahneman auf:
System 1 steht für schnelles, intuitives, oft emotionales Denken.
System 2 beschreibt langsames, reflektiertes, bewusstes Denken.
KI – besonders in sozialen Medien – wirkt oft als Verstärker von System 1, indem sie Inhalte auf Klickrate, Polarisierung und Emotionalisierung optimiert. Die Folge: Oberflächliche Urteile, Fragmentierung von Wahrheiten und ein Verlust der Fähigkeit zu gesellschaftlichem Diskurs.
🌐 Kommunikationsmacht durch Algorithmen
Im Zentrum steht für Ommer die Frage: Wer gestaltet die digitale Öffentlichkeit? KI ist nicht neutral. Sie kuratiert, priorisiert und formt Inhalte. Die kommunikative Beeinflussung geschieht auf mehreren Ebenen:
Aufmerksamkeitsökonomie: Was Aufmerksamkeit bringt, wird algorithmisch belohnt – unabhängig von Wahrheitsgehalt oder gesellschaftlichem Wert.
Filterblasen & Echo-Kammern: Nutzer:innen sehen zunehmend das, was ihre Meinung bestätigt – keine gute Basis für demokratische Prozesse.
Generative Inhalte: KI erzeugt selbst Inhalte – Texte, Bilder, Videos. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen Wahrheit, Simulation und Manipulation.
🧑🤝🧑 Werte, Identität und gesellschaftlicher Zusammenhalt
KI ist nicht nur technisches Werkzeug – sie ist ein kultureller Akteur. Ommer zeigt, wie generative Systeme unsere Vorstellungen von Normalität, Schönheit, Intelligenz und Identität prägen. Besonders problematisch: Wenn KI auf verzerrten Trainingsdaten basiert, reproduziert und verstärkt sie bestehende Vorurteile.
Ein weiteres Beispiel: Selfies mit KI-Filtern oder Avataren verändern unser Selbstbild – subtil, aber wirksam. Damit beeinflusst KI die Art, wie wir uns selbst und andere wahrnehmen.
🏛️ Digitale Souveränität: Europa zwischen Abhängigkeit und Aufbruch
Einer der eindringlichsten Abschnitte der Rede betrifft das Machtverhältnis zwischen den USA und Europa im KI-Bereich:
„Wenn wir nicht aktiv mitgestalten, werden andere über uns gestalten.“ – Björn Ommer
US-Hegemonie: Die führenden KI-Modelle, Plattformen und Infrastrukturen stammen aus den USA. Europa konsumiert – hat aber kaum Kontrolle.
Digitale Kolonialisierung: Wer die KI-Infrastruktur besitzt, kontrolliert die Bedingungen von Kommunikation, Bildung und Innovation.
Europäische Souveränität: Ommer fordert öffentlich finanzierte, transparente Open-Source-KI, die europäischen Werten folgt – ähnlich wie bei Datenschutz (DSGVO) oder Energiepolitik.
⚙️ Technologie nicht nur nutzen, sondern gestalten
KI ist für Ommer kein Schicksal, sondern ein Gestaltungsraum. Er ruft dazu auf, nicht nur Nutzer:innen, sondern Mitentwickler:innen zu sein:
Transparenz statt Black Box
Zugang statt Exklusivität
Ethik statt reinem Profit
Nur wenn KI offen, zugänglich und wertorientiert entwickelt wird, kann sie zu einem Werkzeug gesellschaftlicher Teilhabe werden.
📢 Fazit: Haltung entscheidet
Björn Ommer macht deutlich: KI ist keine neutrale Technologie – sie ist ein Spiegel unserer Werte, Machtverhältnisse und Prioritäten. Die Frage ist nicht, ob wir KI nutzen, sondern wie wir sie gestalten. Europa hat das Potenzial, einen eigenen Weg zu gehen – technologisch, ethisch und gesellschaftlich. Doch dafür braucht es Mut, Investitionen und ein neues Mindset.
„KI ist zu wichtig, um sie nur Technologiekonzernen zu überlassen.“
Für eine vollständige Ansicht des Vortrags können Sie die Aufzeichnung hier ansehen:
Björn Ommer, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitentwickler des KI-Modells Stable Diffusion, hielt auf der re:publica 2025 die Eröffnungs-Keynote mit dem Titel „Generative KI und die Zukunft der Intelligenz“. In seinem Vortrag beleuchtete er die Rolle generativer KI als kritische Ermöglichungstechnologie für den Übergang von einer Informations- zu einer Wissensgesellschaft. Dabei betonte er die Notwendigkeit eines grundlegenden Umdenkens im Umgang mit KI, um Souveränität im digitalen Zeitalter zu bewahren.